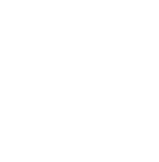Sehr geehrte Leser_innen und Dichter_innen,
Autor_innen, Journalist_innen und alle anderen Interessierten,
die die mediale Debatte der letzten Monate um das Gedicht AVENIDAS von Eugen Gomringer verfolgt oder auch mitgestaltet haben.
Hier kommt ein Rundbrief, den ich ausgehend von meiner Position und Erfahrung als Lehrbeauftragte für Kreatives Schreiben an der ASH Berlin verfasst habe. Falls Ihnen die Zeit fehlt, den gesamten Text zu lesen, dann picken Sie sich gerne einfach die Zeilen heraus, die an Sie gerichtet sind. Sie erkennen sie an dem @ (at = an) in Verbindung mit Ihrem Namen und der kursiv gesetzten Schrift.
Für diejenigen, die sich erst jetzt dazu geschaltet haben:
Es geht hier um eine Diskussion zum Umgang mit dem Gedicht AVENIDAS von Eugen Gomringer. Das Gedicht ziert seit einigen Jahren die Südfassade der Alice Salomon Hochschule in Berlin-Hellersdorf, ist auf Spanisch verfasst und lautet so:
avenidas
avenidas y flores
flores
flores y mujeres
avenidas
avenidas y mujeres
avenidas y flores y mujeres y
un admirador
Auf Deutsch lässt es sich so übersetzen:
alleen
alleen und blumen
blumen
blumen und frauen
alleen
alleen und frauen
alleen und blumen und frauen und
und ein bewunderer
Ich mag das Gedicht. Ich mag seinen Klang (vielleicht auch, weil ich einen Bezug zur spanischen Sprache habe) und ich mag das Prinzip, das dem Gedicht zugrunde liegt. Diese Konstellation aus wenigen Wörtern, die mir eine Welt eröffnet. So, wie die Sternenkonstellationen mich auf Reisen schicken, wenn ich nachts in den Himmel schaue.
@ Sehr geehrter Señor Gomringer:
Wir können sehr viel von Ihnen lernen. Das wissen wir zu schätzen. Deshalb (und auch wegen unserer Bewunderung für Ihr Lebenswerk) hat die ASH Berlin Ihnen 2011 den Alice Salomon Poetikpreis verliehen. Auch die Studierenden, die Ihr Gedicht Avenidas kritisieren, und die sich deshalb wünschen, dass die Südfassade unserer Hochschule anders gestaltet wird, schreiben in ihrem offenen Brief: „Es ist (…) nicht unser Anliegen, das Gesamtwerk Eugen Gomringers in Frage zu stellen.“
Was mir persönlich an AVENIDAS außerdem gefällt: Es lädt zum Spielen ein.
una universidad
una universidad y un poema
un poema
un poema y un poeta
una universidad
una universidad y un poeta
una universidad y un poema y un poeta y
muchas gracias, señor profesor!
[eine universität/ eine universität und ein gedicht/
ein gedicht/ ein gedicht und ein dichter/
eine universität / eine schule und ein dichter/
eine universität und ein gedicht und ein dichter und/
vielen dank, herr professor]
Dank Ihres Gedichts an unserer Hochschule lernen wir gerade sehr viel nicht nur über Lyrik, sondern auch über die Medien, über die Stimmung in unserem Land und über Demokratie im Allgemeinen.
Die ASH Berlin ist eine Hochschule für Soziale Arbeit, Gesundheit und Bildung in Berlin-Hellersdorf mit ca. 3.600 Student_innen, der Großteil davon sind Frauen. Was dort bisher geschah:
Im April 2016 veröffentlichen einige Studierende einen offenen Brief und stellen darin (auch implizit) ein paar Fragen: Warum ziert gerade dieses Gedicht unsere Südfassade? Wer hat das eigentlich so entschieden? Warum sind nicht alle Hochschulangehörigen in die Entscheidung einbezogen worden? (Wie) ließe sich die Fassade anders gestalten?
Einige Hochschulangehörige greifen das Thema auf und diskutieren es, beim Mittagessen in der Mensa, in dem einen oder anderen Seminar, im Rektorat und in einer Kultur-Vorlesung, unter anderem. In der Kultur-Vorlesung sprechen die Beteiligten über das konkrete Gedicht (AVENIDAS), über die Konkrete Poesie und über die Konkordanzregel. Also darüber, wie in unserer Demokratie damit umgegangen wird, wenn verschiedene Grundrechte (hier: Freiheit der Kunst und Diskriminierungsfreiheit) zueinander in Widerspruch geraten. Auch im wichtigsten Entscheidungsgremium der Hochschule, dem Akademischen Senat, in dem alle Gruppen der Hochschule das Stimmrecht haben, werden diese Fragen und Themen diskutiert. Der Akademische Senat beschließt daraufhin, dass es eine hochschulinterne Ausschreibung geben soll, so dass alle, die an der ASH Berlin studieren und arbeiten, Vorschläge für die Neugestaltung der Fassade einreichen können. Eine Abstimmung über die Vorschläge und eine abschließende Diskussion im Akademischen Senat soll dann zu einer Entscheidung führen, an der möglichst viele Hochschulangehörige beteiligt und mit der möglichst viele einverstanden sind.
So funktioniert Demokratie. Und das ist auch gut so. Gerade in Zeiten, in denen demokratische Grundwerte und Prinzipien im In- und Ausland ins Wanken geraten, schätze ich mich glücklich, an dieser Hochschule zu arbeiten, an der die Studierenden unbequeme Fragen stellen und sich (in vielen unterschiedlichen Bereichen) engagieren. Hier hatten ein paar Leute den Mut hat zu sagen „Wir haben eine Kritik an diesem Gedicht“ und die Fähigkeit, sachlich zu begründen, warum sie sich für die Hochschulfassade eine andere Gestaltung wünschen.
Ich mag das Gedicht. UND ich finde die Kombination von Alleen, Blumen, Frauen und einem Bewunderer tatsächlich auch ein bisschen altmodisch. Die Verfasser_innen des offenen Briefes sehen darin „eine klassische patriarchale Kunsttradition (reproduziert), in der Frauen* ausschließlich die schönen Musen sind, die männliche Künstler zu kreativen Taten inspirieren“. Mit dieser Kritik kann ich etwas anfangen – und ein Gegengedicht schreiben:
landstraßen
landstraßen und männer
männer
männer und pferde
landstraßen
landstraßen und pferde
landstraßen, männer und pferde und
eine fragenstellerin
Dass AVENIDAS einigen von uns in der Auswahl und Zusammenstellung der Worte etwas antiquiert anmutet, hat vielleicht auch damit zu tun, dass es schon etwas älter ist. Klar, der Eindruck, dass es hier um Objekte (Alleen, Blumen, Frauen) und ein betrachtendes Subjekt (ein Bewunderer) als (heterosexuelles?) lyrisches Ich geht, ist nur ein Eindruck. Wir wissen es nicht. Das ist eigentlich das Tolle an Gedichten. Du und ich können sie so und/oder so interpretieren. Und unterschiedliche Leute lesen daraus dies und/oder das. Was dann die Dichterin damit sagen wollte (oder der Dichter) ist noch eine ganz andere Frage, die auch nicht immer endgültig geklärt werden kann. Wunderbar ist doch, wenn Gedichte zur Diskussion anregen. Da bin ich mit Herrn Gomringer („Dass man mit so wenigen Worten so eine Wirkung erzielt, das war immer mein Ziel.“ Süddeutsche Zeitung vom 6.9.17) und Frau Stokowski („Eine Lyrik-Debatte, wie schön eigentlich!“ Spiegel online vom 5.9.17) einig.
@ Sehr geehrte Margarete Stokowski, Heide Oestreich und Barbara Koehler: Vielen Dank für Ihre differenzierten Beiträge zur Debatte. Ich habe mich sehr darüber gefreut!
@ Liebe Nora Gomringer: Sie betonen in einem Interview in der Kulturzeit das UND in dem Gedicht und damit das verbindende Element, das darauf verweise, dass es in dem Gedicht vielmehr um einen Ausgleich (statt um Abwertung oder Diskriminierung) gehe. Diese Argumentation kann ich in gewisser Weise nachvollziehen, frage mich aber gleichzeitig, warum Ihre kritische Sicht auf Geschlechterverhältnisse und Rollenklischees, die Sie an anderer Stelle zum Ausdruck bringen hier unter den (Küchen-?) Tisch fällt (Achtung: auf der verlinkten Seite bitte runterscrollen, um den Beitrag von Nora Gomringer zu finden),.
Aber ich bin vom Thema abgekommen. Zurück zum (vermuteten) lyrischen Ich. Zugegeben, „una admiradora“ (eine Bewundernde) am Ende des Gedichts würde auch ein schönes Bild hervorrufen, liest sich aber einfach nicht so gut wie „un admirador“. Und klingt auch etwas holprig. Aber sind „altmodisch“ oder „es erinnert an eine klassisch patriarchale Kunsttradition“ Gründe, das Gedicht gleich zur Diskussion zu stellen? Gegenfrage: Warum eigentlich nicht? Diskussion und Debatte sind doch super. Die gehören in unserer Demokratie ja dazu.
@ Sehr geehrte Sandra Kegel und Jan Wiele von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung:
Sie stellen in Ihrem Beitrag viele Fragen und ich werde den Eindruck nicht los, dass Sie auf die meisten Ihrer Fragen die Antwort schon im Vorwege wussten. Außer vielleicht auf diese Frage: „Kann Bewunderung herabsetzend sein?“ Ja, das kann sie. Haben Sie das noch nie erlebt? Dass Ihnen ein Kompliment gemacht wird und dass in dem Kompliment noch ganz andere Botschaften mitschwingen? Zum Beispiel, dass Sie nicht dazu gehören oder bemitleidenswert sind. Mir – bzw. einigen Menschen in meinem Umfeld – begegnet das fast täglich: Ich stehe mit einem befreundeten Jungen an der Ampel, eine alte Dame stellt sich dazu, schaut auf meinen 9-jährigen Freund herab und sagt: „Du kannst aber gut Rollstuhl fahren! Wie tapfer du bist!“. Diese Art von Bewunderung, die nervt. Ziemlich! Auch wenn die Dame es bestimmt nicht böse gemeint hat. Oder gut gemeinte Komplimente wie „Sie sprechen aber gut Deutsch!“ für Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind, aber nicht als deutsch angesehen werden. Oder „Dafür, dass sie so dick ist, sieht sie echt super aus!“ über Frauen, die nicht Kleidergröße 38 tragen. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.
Ich glaube nicht, dass irgendjemand denkt, das Gedicht AVENIDAS sei in böser Absicht verfasst worden. Oder dass damit Frauen bewusst abgewertet oder diskriminiert werden sollten. Das Problem ist nur, es lässt sich so und so lesen und interpretieren. Und es löst es bei diversen Menschen diverse Assoziationen aus. Die Studierenden schreiben in ihrem offenen Brief: „ Zwar beschreibt Gomringer in seinem Gedicht keineswegs Übergriffe oder sexualisierte Kommentare und doch erinnert es unangenehm daran, dass wir uns als Frauen* nicht in die Öffentlichkeit begeben können, ohne für unser körperliches ‚Frau*-Sein‘ bewundert zu werden. Eine Bewunderung, die häufig unangenehm ist, die zu Angst vor Übergriffen (…) führt.“
Ehrlich gesagt wäre ich selbst nicht auf diesen Zusammenhang gekommen. AVENIDAS hat bei mir (zunächst) nicht den Gedanken an zudringliche männliche Blicke oder sexistische Übergriffe ausgelöst. Trotzdem finde ich es wichtig, es ernst zu nehmen, wenn es anderen Menschen da anders geht. Ich kann die Begründung nachvollziehen und denke, es ist sinnvoll, darüber zu sprechen. Die Studierenden geben uns einen wichtigen Hinweis, indem sie sagen „Diese Zeilen erinnern uns an etwas, was wir täglich erleben: grenzüberschreitende Blicke und sexualisierte Gewalt im öffentlichen Raum.“ (Wer mehr darüber erfahren möchte, dem seien, nur nebenbei bemerkt, die hashtags #MeToo und #aufschrei sowie der Heimweg-Blog der taz empfohlen, auf dem Frauen* von Übergriffen berichten, die sie erlebt haben, im Öffentlichen und im Privaten.) Übrigens fühlen sich nicht nur einige Frauen* in vielen öffentlichen Räumen (und unter anderem am U-Bahnhof Hellersdorf und auf dem Alice Salomon Platz) nicht sicher. Auch Menschen, die als nicht-deutsch angesehen werden, erleben in der Öffentlichkeit verdachtsunabhängige Kontrollen, rassistische Äußerungen bis hin zu tätlichen Übergriffen.
Was mir an der aktuellen Debatte noch einmal deutlich wird: Wer solche Hinweise ausspricht, wer darauf aufmerksam macht, dass bestimmte Worte (und Handlungen) verletzend sein können, der lebt „gefährlich“. Der muss mit ziemlich vielen Anfeindungen rechnen. Der AStA (Allgemeine Studierendenausschuss), der den offenen Brief unterstützt hat, erlebte einen Shitstorm. In Emails und Kommentaren auf der Facebook-Seite wurden die Mitglieder des AStA mit hasserfüllten, beleidigenden und bedrohlichen Äußerungen überschüttet, die zudem antifeministische bis hin zu antidemokratischen und rechtsextremen Positionen spiegelten. Ähnlich erging es zwei Autorinnen, die in der taz einen Beitrag über sexualisierte Gewalt veröffentlichten.
Shida Bazyar beschreibt in einem Artikel in der taz – anhand der Metapher des grüngelben Schleims – sehr eindrücklich, dass sie es sich genau überlegt, ob sie das Risiko auf sich nimmt, auf rassistische Äußerungen, durch die sie sich verletzt fühlt, aufmerksam zu machen oder lieber nicht:
„Stellen wir uns vor, es ginge nicht um Rassismus, sondern um grüngelben Schleim. Stellen wir uns vor, dass manche Menschen grüngelben Schleim aus den Ohren sprühen, ohne es zu merken. Und dass dieser Schleim giftig für einen kleinen Teil der Menschheit ist.
Die meisten Menschen denken: „Schleim? War da Schleim? Ich glaub nicht, ich seh ihn nicht.“ Wie auch? Die Augen schauen nach vorn, der Schleim kam links und rechts aus dem Kopf raus. Der kleine, betroffene Teil dagegen weiß ganz genau: „Das ist Schleim. Das ist Gift für mich. Ich will das nicht!“ Alle schauen sich fragend um. Nichts zu sehen. Der kleine Teil der Menschheit muss sich wohl geirrt haben.
Bei so etwas irrt man sich als Betroffene*r aber nicht. Ganz sicher nicht. Denn es wäre ja viel schöner, wenn man so etwas nicht sagen müsste. Niemand möchte gern zur nörgelnden Minderheit gehören.“
Das bringt mich auf ein Gedicht von May Ayim, mit dem wir uns in einem Seminar zum Kreativen Schreiben beschäftigt haben, als wir auch über das AVENIDAS Gedicht und den Offenen Brief sprachen und dazu neue Konstellations-Gedichte verfassten.
Das Gedicht von May Ayim heißt KÜNSTLERISCHE FREIHEIT und findet sich in ihrem Buch „blues in schwarz weiß. Gedichte.
(1996: Berlin: Orlanda Frauenverlag, S. 78):
künstlerische freiheit
alle worte in den mund nehmen
egal wo sie herkommen
und sie überall fallen lassen
ganz gleich wen es
trifft
Ob May Ayim mit diesem Gedicht für die Freiheit der Kunst (und damit auch ihrer Kunst) eintritt oder ob sie vielmehr kritisiert, dass die künstlerische Freiheit als Deckmantel für verletzende Worte missbraucht werden kann, war für uns im Seminar abschließend nicht zu klären. Vielleicht trifft ja auch beides zu?
Dass May Ayim als Afro-Deutsche mit sehr vielen verletzenden Worten, Blicken und „Komplimenten“ aufwachsen und leben musste, lässt sich (auch) in ihren Gedichten nachvollziehen. Gerne würde ich sie fragen: Wie hast Du das gemeint, das, mit der künstlerischen Freiheit, May? gerne würde ich ihr sagen: Du fehlst uns. Du und Deine Poesie. Du und Deine Kunst, Deine Freiheit und Dein Mut, unbequeme Dinge anzusprechen.
@ Sehr geehrte Regula Venske und Christoph Hein vom PEN-Zentrum Deutschland e.V.,
es tut mir leid, aber Ihre Pressemitteilung vom 5.9.17 verstehe ich nicht. Okay, ich habe schon verstanden, dass Sie sich wünschen, dass die ASH Berlin ihre Südfassade mit den AVENIDAS behält. Das wünschen sich ja noch einige andere Leute. (Und vielleicht wird dieser Vorschlag ja auch von dem einen oder der anderen Hochschulangehörigen genauso eingebracht. Wer weiß? Vielleicht wird er sogar als Sieger aus dem partizipativen Auswahlverfahren hervorgehen. Dann bliebe alles beim Alten – und es hätte sich doch etwas bewegt.) Was ich nicht verstehe, das sind Ihr Stil, die Beleidigungen, die Sie aussprechen und die Vergleiche, die Sie ziehen. Sie schreiben von einer „Entwicklung, die darauf abzielt, der Kunst einen Maulkorb vorzuspannen oder sie gar zu verbieten“. Sie sprechen von „Zensur“ und „barbarischem Schwachsinn“ und ziehen Analogien zur „Bilderstürmerei in Vergangenheit und Gegenwart“. Dem Rektor werfen Sie vor, er würde unberechtigten Forderungen opportunistisch Folge leisten und den Studierenden unterstellen Sie „unerzogene Unbildung“ und „Kultur- und Bildungsferne“. Das ist, wie ich finde, ein ziemlich starkes Stück. Das mir (fast) die Sprache verschlägt. Was geht hier ab? Warum reagieren Sie so empfindlich? Warum schauen und hören und lesen Sie nicht genau hin? Hat das mit der deutschen Geschichte zu tun? Oder damit, dass Studierende sich trauen, das Gedicht eines der großen Dichter des Landes zu kritisieren? Oder hat es (noch) ganz andere Gründe? Das würde ich wirklich gerne verstehen.
Vielleicht können Sie es mir erklären?
Die Autor_innen des Offenen Briefes und auch die ASH Berlin sind keine Staaten, die Zensur ausüben, geschweige denn Berufsverbote oder Gefängnisstrafen verhängen könnten. Da liegt eine Verwechslung vor. Hier wird niemandem irgendetwas verboten. Es haben lediglich ein paar Studierende gesagt „Wir haben eine Kritik an diesem Gedicht. Wir wünschen uns für unsere Hochschule eine andere Fassadengestaltung. Und wir setzen uns ein für partizipative Entscheidungsprozesse ein, wenn es um die Räume und um die Außendarstellung unserer Hochschule geht.“
Solch eine Kritik kann und muss Kunst – und können und müssen wir – aushalten, finde ich. Dass die Studierenden sich mit ihrer Hochschule identifizieren und an ihrer Gestaltung ein Mitspracherecht haben möchten, das finde ich sehr erfreulich und unterstützenswert. Und wie gesagt, wie dieser Prozess ausgeht, ist ja noch offen.
Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann wünschte ich uns eine andere öffentliche Diskussions- und Streitkultur, eigentlich eher eine Dialog-Kultur. In der wir einander zuhören und versuchen zu verstehen. Statt mit rhetorischen Fragen, Kraftausdrücken und schiefen Vergleichen um uns zu werfen. Und ich wünschte mir noch mehr mutige, engagierte und kritische Studierende wie diejenigen, die den offenen Brief verfasst haben. Junge Menschen, die nach den Sternen und den Worten greifen, die Konstellationen und Konventionen durcheinander wirbeln, so dass wir alle beweglich bleiben und noch viel dazu lernen dürfen, über Gedichte und Demokratie und ein diskriminierungsfreies Leben.
Mit freundlichen feministischen Grüßen in die Runde,
Nadja Damm
P.S.: Hier noch der Verweis auf zwei sehr lesenswerte Stellungnahmen aus der ASH Berlin zur Debatte: von Seiten des Rektorats und des AStA.